23. März 2018 von Manfred Rekowski
Man kann sich einfach und schnell empören, besonders einfach geht dies, wenn man sich für eine gute Sache einsetzt. Der Missbrauch von Facebook-Nutzerdaten durch Cambridge Analytica ist unerhört. Je mehr Einzelheiten bekannt werden, desto größer werden die Ausmaße des Skandals. Auch wenn sich Facebook anfänglich als Opfer gerierte, ist Facebook verantwortlich für die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer. Es ist gut und richtig, dass die Politik nun Aufklärung fordert und Facebook Konsequenzen verspricht.
Es wird aber keine einfache Lösung geben, sondern das Problem ist ein grundsätzliches. Facebooks Geschäftsmodell – und das anderer sozialer Netzwerke und Internetdienstleister – ist offensichtlich: Daten sammeln, um diese zu vermarkten. Die personenbezogenen Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer sind das Kapital, um damit passgenau Werbung anzubieten: sei es, um Produkte zu bewerben oder um Wahlentscheidungen zu beeinflussen. Die Methoden sind dabei so subtil, dass viele User Facebook-Marketing nicht einmal als Werbung wahrnehmen.
Das Geschäftsmodell von Facebook funktioniert, weil Menschen erwarten, dass Facebook kostenlos seine Dienste anbietet, und sie gleichzeitig bereit sind, dafür Facebook ihre Nutzerdaten zu offenbaren und deren Verkauf und Nutzung zu Werbezwecken zu gestatten.
Jeder, der Facebook – oder auch Google oder Snapchat, um auch andere Firmen zu nennen – nutzt, weiß oder könnte oder müsste wissen, dass er für diese Online-Dienste mit seinen Daten bezahlt und die Hoheit über seine Daten abgibt. Der Skandal um Cambridge Analytica zeigt daher symptomatisch die Problematik sozialer Netzwerke wie Facebook auf. Hoffentlich führt dies dazu, dass das Geschäftsmodell von Facebook grundsätzlich von seinen Usern in Frage gestellt wird.
Es geht aber nicht nur um Werbung, Facebook liefert auch andere Inhalte wie Nachrichten passgenau aus. Nicht was wahr ist, wird den Nutzerinnen und Nutzern angezeigt, sondern was ihnen gefällt. Je länger jemand auf Facebook surft, desto wertvoller ist er als Empfänger von Werbung, gleichzeitig produziert er noch mehr Daten durch sein Nutzerverhalten, die noch mehr über ihn preisgeben. Facebook ist bei der Auswahl seiner Inhalte nicht an journalistische Standards gebunden, sondern optimiert seine Algorithmen so, dass Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange im eigenen Netzwerk gehalten werden.
Der Skandal um Cambridge Analytica stellt uns nun dringlich Fragen, die wir schon längst hätten angehen sollen, als einzelne, als Gesellschaft und als Kirche. Was können wir tun? Empörung ist mir zu wenig.
Persönlich heißt das für mich: Als Verbraucher will ich nicht mehr das Prinzip akzeptieren, dass ich für Internet-Dienstleistungen mit meinen Daten bezahle. Ich werde mir für mein privates E-Mail-Konto einen Anbieter suchen, der gegen Geld E-Mail-Dienste anbietet, dafür aber nicht meine Daten auswertet.
Im Supermarkt habe ich nicht bei allen, aber bei einigen Produkten Wahlmöglichkeiten. Beim Kaffee-Regal kann ich mich zwischen Fairtrade-Kaffee oder anderen Produkten entscheiden, bei Eiern zwischen solchen aus Freilandhaltung oder Käfighaltung. Als Verbraucherinnen und Verbraucher können wir mitentscheiden, welche Produkte marktfähig sind und werden. Es war ein langer Weg, bis Fairtrade-Produkte den Weg in die Regale fanden. Ob Kaffee, Eier oder E-Mail: wo ich als Verbraucher die Wahl habe, will ich bewusst meine Kaufentscheidung treffen. Das gilt für Güter des täglichen Lebens, aber auch für digitale Dienstleistungen.
In Gesellschaft und Politik sollten wir diskutieren, wie Facebook und andere Dienstleister reguliert werden. Wenn Facebook für viele Menschen die Nachrichten aus der „Tagesschau“ ersetzt und so zum Grundversorger wird, müssen auch entsprechende Regeln gelten wie für andere Medienanbieter – und diese Regeln müssen auch durchgesetzt werden. Dass die neue EU-Datenschutzgrundverordnung auch für Facebook gilt, ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Als Kirche müssen wir aber auch unsere eigenen sozialethische Positionen weiterentwickeln und diese in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Digitalisierung ist auch eine Aufgabe für die Theologie.
Für uns als Kirche heißt dies auch: Wir nutzen soziale Netzwerke wie Facebook nicht deshalb, weil uns deren ethischen Maßstäbe besonders gut gefallen, sondern weil wir an allen Orten den Menschen die Gute Nachricht schuldig sind. Deshalb halten wir die Morgenandacht im WDR und auch die #microandacht auf Facebook. Aber es gilt auch: Wir ziehen niemanden nach Facebook hinein, sondern wenden uns an die Menschen, die bereits auf Facebook sind. Wir wollen Facebook weiterhin verantwortungsvoll nutzen, deshalb beobachten wir die Entwicklung sorgfältig. Das gilt für die institutionelle Präsenz der Landeskirche und für mein persönliches Konto als Präses. Wir nutzen Facebook, um Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen, machen uns aber nicht abhängig, denn wir wissen: Wir sind nur Gast auf Facebook.
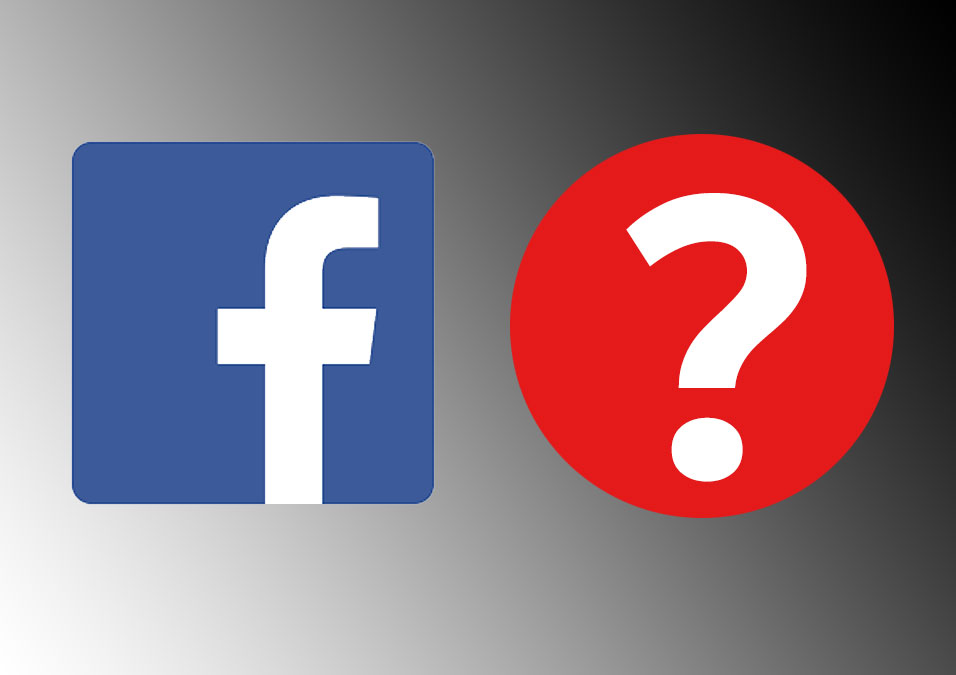 23. März 2018 von Manfred Rekowski
Man kann sich einfach und schnell empören, besonders einfach geht dies, wenn man sich für eine gute Sache einsetzt. Der ...
23. März 2018 von Manfred Rekowski
Man kann sich einfach und schnell empören, besonders einfach geht dies, wenn man sich für eine gute Sache einsetzt. Der ...
Genau so! Nicht weil wir Facebook so lieben,
sondern weil wir als Menschen, als Christen
gemeinsam miteinander unterwegs sein wollen!
Herzliche Grüße vom Niederrhein
Selbst in dieser kritischen, diffenrenzierten Stellungnahme zu den „Sozialen“ Medien werden die Mechanismen der „Geschäfts“-Modelle nicht ansatzweise erklärt und transparent gemacht, sodass über 90 von 100 Nutzern nicht verstehen, was passiert und also nicht bewußt und selbst entscheiden können.
Einzelne, ganz wenige Schulprojekte gibt es schon, die Mädchen aufklären helfen.
Wenn schon keine Instanz das alles verbietet, dann gehört aber doch Werbung gemacht, für den völligen Verzicht auf „soziale“ Medien, die ihrer Idee entsprechend asozial wirken wollen.
Für´s menschliche reichen Briefe oder mails.
„weil wir an allen Orten den Menschen die Gute Nachricht schuldig sind“.
Nix da: Die gute Nachricht muss in Bezug auf alle „sozialen Medien“ heißen: Wir sind für unsere Daten selbst verantwortlich und wir behalten die Verantwortung!
Ich bin nur auf Facebook, weil ich auf bestimmten Seiten mitdiskutieren möchte. Ich habe nichts auf meiner Seite, ich like nichts, ich habe keine faebookfreunde, ignoriere jede Anfrage. Im Moment überlege ich aber, ob ich meinen account lösche. Nur die Tatsache, dass für mich wichtige foren auf Gesichtsheftchen sind, lässt mich zögern. Wenn alle noch ein zweites Standbein hätten wie die ekir mit diesem blog, dann wäre ich schon raus. Also großes Lob dafür, dass Visagenbuch nicht das einzige Standbein ist!
Aber ich wünsche mir mehr: Dass der blog ausgeweitet wird und die fb-Seite praktisch nur noch aus einer Verlinkung zum blog besteht. Das hättte den Vorteil., dass Menshen merken, dass es auch ohne fb geht. Und vielleicht ziehen dann andere nach…
Ich möchte den guten Argumenten widersprechen. Dass im Zuge der aktuellen Diskussion sehr früh die Hannoversche Kirche von der ARD befragt wurde, ob sie ihre Präsenz auf Facebook beenden werde, zeigt, dass die Öffentlichkeit in der Frage ob FB genutzt werden kann, moralische Leitlinien sucht. Und wir bringen den Mut nicht auf, zu unseren Werten zu stehen. Es ist m.E. eine Frage der Freiheit und damit eine evangelische, ob mir mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wenigstens in Teilen erhalten bleibt, oder mit Anmeldung bei einem Dienst fast vollständig genommen wird. Facebook kennt keine quasi passiven Gäste. Jedes Datenbit, das hier gesendet wird, stützt das Monopol des Anbieters. Bedrohlich wird es nicht erst durch die Weitergabe der Daten an Cambridge Analytica, sondern schon dort, wo man als Nicht-Facebook-Mitglied Erfahrungen von Ausgeschlossen-Sein macht. Spannend zum Beispiel die Frage, ob man in der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit heute noch eine Stelle bekommen würde mit der Einschränkung, keine Inhalte für FB bereitstellen zu wollen. Oder auch die Frage, welche innerkirchlichen Willensbildungsprozesse durch Diskurse auf FB-Foren angebahnt oder mitgeprägt werden. Ich weiß nicht, ob es so ist, weil ich ja nicht teilnehme. Aber allein die Furcht, es könnte so sein, fühlt sich befremdend an.
Solange das Geschäftsmodell sozialer Netzwerke auf umfassender Datenerfassung und Profilierung des Einzelnen beruht, sehe ich diese Dienste im Widerspruch zu meinem, auch von der Bibel geprägten, Menschenbild.
Dem Präses stimme ich völlig zu, daß Facebook keine ethischen Maßstäbe setzt, die mir gefallen müssen. Und natürlich sind wir nur Gast auf Facebook – übrigens eine sehr intelligente Formulierung.
Gleichzeitig bezweifle ich, ob es zielführend ist, jetzt für Dienste wie Facebook bezahlen zu wollen, und stattdessen die „Hoheit über seine Daten“ behalten zu wollen. Jeden Sonntag erlebe ich, wie der Pfarrer auf der Kanzel seine Predigt über abstrakte biblische Texte mit Daten aus seinem Leben würzt.
Das gehört für mich als Christ einfach dazu, daß ich eben nicht die Hoheit über meine Daten habe, sondern daß ich andere daran teilhaben lasse. Und dieser „andere“ kann mein kranker Nachbar, aber eben auch Mark Zuckerberg sein.